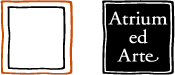Gyula Fodor zeigt in der Ausstellung «Wien verschwindet» Fotografien aus einer Stadt, die wir zu kennen glauben. Die schwarze Silhouette eines mächtigen Gebäudes, dessen Attikafiguren sich gegen den abendlichen Himmel abzeichnen. In der Schwärze dieses architektonischen Körpers glüht zaghaft eine steinerne Figurengruppe - Laokoon? Oder die riesige Leinwand, auf der gerade die Ereignisse des 11. September 2001 gezeigt werden vor einer düsteren Skyline von Hochhäusern - sind es Gebäude in Boston, Frankfurt oder Kagran?
Der Fotograf meint: «Politiker mit nationalem Bewusstsein wollen Wien mit allen möglichen Bindemitteln auf dem Boden festhalten. Nützt nichts. Wien hat schon abgehoben mit Kurs auf internationale City. Diese Ballonfahrt beginnt aber holprig und zögernd, deshalb bleibt der Wiener Lokalismus als Horizont noch sichtbar. Die Ringstraße oder der Schwarzenbergplatz sind weltbekannte Orte, die nicht mehr auf ihrem Platz sind...»
So suchen wir vergeblich nach «gewohnten» Wien-Ansichten in Fodors Bildern. Die vertrauten Orte dieser Stadt verschwinden, lassen im Betrachter Unsicherheit zurück. Er sieht statt der möglicherweise erwarteten Abbildungen Motive, die ihm fremd sind, die ihm die Identifikationsfläche entziehen, ihn jedoch auf einer anderen Ebene wahrnehmen lassen und, so paradox es klingen mag bei einer Ausstellung mit bildender Kunst, nicht nur auf der optischen. Atmosphärisch haben diese Fotografien etwas von einem Krater mit doppeltem Boden darüber. Oft ist die Szenerie von einem eigenartigen Zwielicht beherrscht. Hier kommt zum Ausdruck, wie Fodor Wien empfindet: «Zwischen Leben und Jenseits.»
Der Künstler hat sich auch nach vielen Jahren in Wien die Fähigkeit bewahrt, bekannte Plätze immer wieder neu zu sehen. «Wenn die Umgebung sich ändert, ändern sich unsere Augen,» sagt Fodor. «Mit diesem Blick habe ich die Stadt mit und ohne Menschen fotografiert. Der ständig sich ändernden Art und Weise des Sehens möchte ich auch stilistisch folgen. Das tue ich mit verschiedenen Methoden wie der traditionellen «Fine Art Photography», Farbfotos und einer neuen Technik mit Polaroidfilmen, die ich dann in Cibachrom ausarbeite.»
Eine Reihe von Schwarz/Weiß-Fotografien auf Baryt zeigt einen anderen Aspekt Wiens.
«Drei U-Bahnstationen, fünf Minuten nur, trennen die Wiener Innenstadt vom Barnabitenplatz im 6. Bezirk. Wer dort in der City, in der Fußgängerzone sich buchstäblich querlegt, wer stört, soll besser verschwinden. In der "Gruft" bei der Barnabitenkirche stören sie nicht, die Obdachlosen, da sind sie willkommen. Gyula Fodor hat den Betrieb im Winter in der «Gruft» festgehalten: unsentimental, weder ausbeuterisch noch beschönigend, weder schwarz noch weiß, wenn auch in diesem Medium - eine gelungene Dokumentation des anderen Wien.» (Michael Freund, Der Standard)